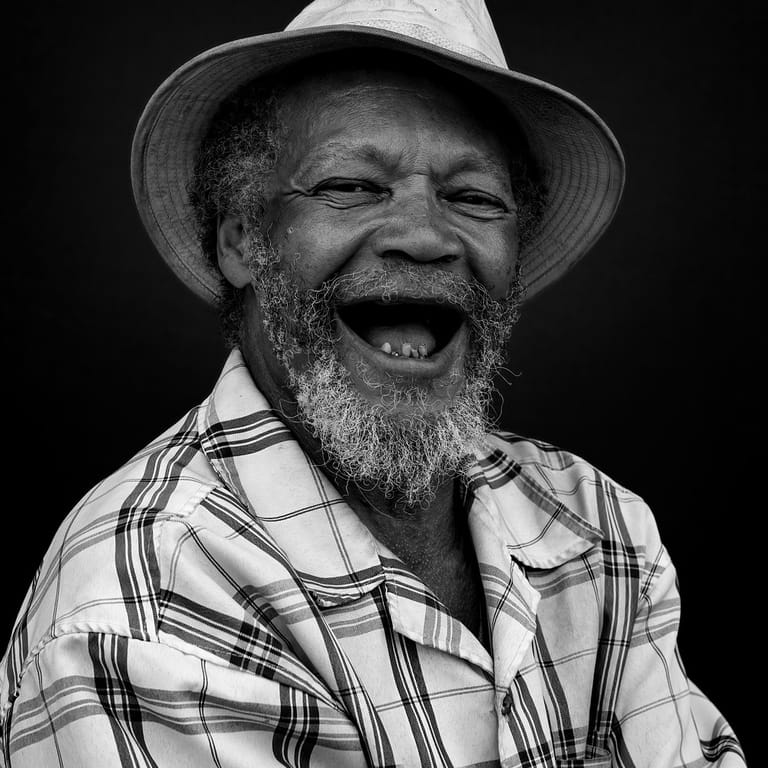Keine Heilung mehr bedeutet nicht zu Sterben
Ist eine Heilung nicht mehr möglich, rückt die Lebensqualität in den Mittelpunkt. Palliativmedizin begleitet Menschen und ihre Angehörigen in dieser Phase ganzheitlich.
Diagnose einer unheilbaren Erkrankung
von Dr.in med. univ. Elisabeth Sciri
Die Diagnose einer unheilbaren Erkrankung ist für jeden Menschen ein Schock.
Sei es, dass eine Erkrankung, gegen die man lange gekämpft hat, wiedergekommen ist oder nicht mehr auf Therapien anspricht; sei es, dass bereits bei der Erstdiagnose eine so weit fortgeschrittene Situation besteht, dass eine Heilung nicht mehr möglich ist.
Wenn eine Heilung therapeutisch nicht mehr möglich ist, werden andere Dinge für den betroffenen Menschen wichtig. In diesem Lebensabschnitt sollte die Lebensqualität der wichtigste Faktor sein. Diese sollte für alle betreuenden Personen eine zentrale Rolle spielen.
Säulen der Lebensqualität
Die Lebensqualität eines erkrankten Menschen setzt sich aus mehreren Dimensionen zusammen:
Physische Dimension: Kontrolle und Linderung körperlicher Beschwerden, z. B. Schmerzen
Psychische Dimension: emotionales und kognitives Wohlbefinden
Soziale Dimension:
Einbeziehung und Entlastung der Angehörigen
fachliche Unterstützung in sozialen Aspekten (Finanzen, Versorgung, Hilfsmittel)
Spirituelle Dimension: Fragen nach Sinn und Identität, Umgang mit Leid, Schuld, Verantwortung, Hoffnung, Liebe, Freundschaft; Werte und Werthaltungen; religiöse Aspekte oder Glaubensgrundhaltungen
Palliativmedizinische Betreuung
In der Palliativmedizin versuchen wir, alle diese Bereiche auch personell abzudecken, um die Lebensqualität der Patient:innen so hoch wie möglich zu halten.
Wir arbeiten in multiprofessionellen Teams mit:
Ärzt:innen
diplomiertem Pflegepersonal
Sozialarbeiter:innen
Psycholog:innen
Physiotherapeut:innen
Seelsorger:innen
Versorgungsangebote
Mobile Teams und spezialisierte Ambulanzen ermöglichen es, dass Menschen so lange wie möglich zuhause bleiben können und auch die letzte Lebensphase, inklusive des Versterbens, im häuslichen Umfeld verbringen können.
Palliativstationen und Hospize begleiten Betroffene, wenn eine Versorgung zuhause nicht mehr möglich ist. Auch hier steht die Lebensqualität in all ihren Facetten im Mittelpunkt.
Die betreuenden Teams versuchen, die Patient:innen in Würde zu versorgen. Das bedeutet auch, den hektischen Klinikalltag so weit wie möglich auszublenden und Angehörigen viel Raum zu geben, um da zu sein und – wenn gewünscht – mitzuhelfen.
Palliativmedizin beginnt früh
Palliativmedizin beginnt weit vor der letzten Lebensphase.
Es gibt heute immer mehr Therapieangebote wie zum Beispiel palliative Chemotherapien, die zum Ziel haben:
Lebenszeit zu verlängern
Symptome zu reduzieren, die mit dem Fortschreiten der Erkrankung einhergehen würden
Best supportive care
Wenn palliative Therapien nicht mehr positiv zur Lebensqualität beitragen, ändert sich das Therapiekonzept in Richtung „Best supportive care“ (= beste unterstützende Behandlung).
Im Vordergrund steht dabei die Linderung von Symptomen einer schweren Erkrankung.
Je nach den Bedürfnissen der erkrankten Person kann dies beinhalten:
Schmerzlinderung
psychologische Unterstützung
Alltagshilfen
Quellen:
World Health Organization. (o. J.). Palliative care. Abgerufen am 19. September 2025, von https://www.who.int/health-topics/palliative-care
Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, & AWMF). (2021, Februar). Erweiterte S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung (Kurzversion 2.3). AWMF-Registernummer 128/001OL. Abgerufen am 19. September 2025, von https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Leitlinien/Palliativmedizin/Version_2/LL_Palliativmedizin_Kurzversion_2.3.pdf