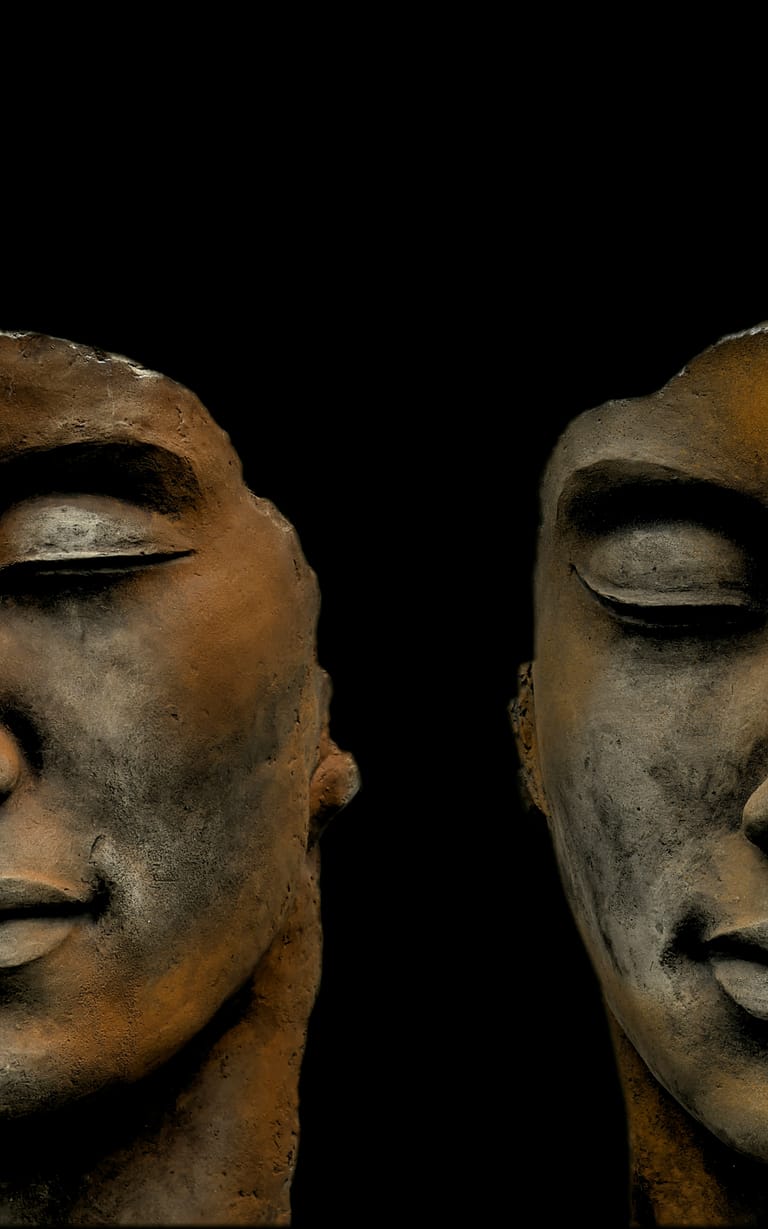Unterschiedliche Trauerwege
Menschen trauern auf ganz unterschiedliche Weise – Männer, Frauen, Kinder und Erwachsene, aber auch Kulturen und Religionen. Dieser Beitrag zeigt, wie vielfältig Trauer sein kann und gibt Orientierung im Umgang damit.
Allgemeines
Trauer ist so vielfältig wie die Menschen selbst. Jede und jeder erlebt sie anders – manchmal leise und zurückgezogen, manchmal sichtbar und laut, manchmal in Wellen zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“. Unterschiede zeigen sich nicht nur zwischen einzelnen Menschen, sondern auch zwischen Frauen und Männern, Erwachsenen und Kindern, ebenso wie zwischen Kulturen und Religionen. Diese Vielfalt zu kennen, kann helfen, die eigene Trauer besser zu verstehen und die Trauer anderer anzunehmen.
Männer und Frauen in der Trauer
Männer und Frauen drücken ihre Trauer oft unterschiedlich aus – wobei es sich um Tendenzen handelt, nicht um feste Regeln.
Frauen zeigen ihre Gefühle häufiger nach außen. Sie suchen Gespräche, weinen gemeinsam oder verarbeiten ihre Trauer im Austausch mit anderen.
Männer neigen eher dazu, ihre Trauer im Tun zu leben. Arbeit, praktische Aufgaben oder sportliche Aktivität können helfen, mit dem Schmerz umzugehen. Manche Männer fühlen sich verpflichtet, „stark“ zu bleiben, was offene Trauer erschwert.
Umgang: Beide Ausdrucksformen verdienen Respekt. Frauen brauchen oft ein offenes Ohr, Männer eher Freiraum und die Möglichkeit, im Handeln Halt zu finden. Wichtig ist, weder Redebedarf noch Rückzug zu bewerten, sondern Verständnis für den jeweils eigenen Weg zu zeigen.
Kinder in der Trauer
Kinder erleben und zeigen Trauer anders als Erwachsene. Sie verstehen den Tod je nach Alter sehr unterschiedlich – und brauchen eine besonders klare und einfühlsame Begleitung.
Kleinkinder (bis ca. 3 Jahre): Sie begreifen den Tod noch nicht als endgültig. Sie spüren jedoch sehr deutlich die Abwesenheit und reagieren mit Weinen, Unruhe oder anhänglichem Verhalten.
Umgang: Nähe, Körperkontakt und ein verlässlicher Tagesrhythmus geben Sicherheit.Vorschulkinder (3–6 Jahre): In diesem Alter wird der Tod oft als etwas Umkehrbares wahrgenommen. Typisch sind Fragen wie „Wann kommt Papa wieder?“ oder Spiele, in denen der Tod nachgestellt wird.
Umgang: Ehrliche, einfache Worte sind entscheidend. Es ist wichtig, wirklich von „Tod“ zu sprechen und nicht zu sagen, dass jemand „schläft“ oder „weggegangen“ ist – sonst kann Angst entstehen, selbst beim Einschlafen nicht mehr aufzuwachen.Grundschulkinder (6–12 Jahre): Kinder in diesem Alter verstehen, dass der Tod endgültig ist. Gefühle wie Wut, Schuldgefühle oder Traurigkeit können auftreten und wechseln sich mit Momenten von Spiel und Ablenkung ab.
Umgang: Kinder sollten in Abschiedsrituale einbezogen werden. Erinnerungsstücke oder kleine Aufgaben (z. B. eine Blume ins Grab legen) helfen, den Verlust zu verarbeiten.Jugendliche: Jugendliche begreifen den Tod in seiner ganzen Tragweite, erleben aber oft widersprüchliche Gefühle. Manche suchen Nähe, andere ziehen sich zurück. Trauer kann sich in Schweigen, Rebellion oder Rückzug äußern.
Umgang: Sie brauchen Raum, ihre Gefühle ernst genommen zu wissen, aber auch die Möglichkeit, in ihrem eigenen Tempo darüber zu sprechen. Halt, Grenzen und Vertrauen sind wichtig.
Kinder und Jugendliche brauchen Erwachsene, die ehrlich sind, zuhören und ihnen zeigen: „Du darfst traurig sein – und du darfst trotzdem auch lachen und spielen.“
Kulturen und Religionen
Wie Trauer gelebt wird, hängt stark von kulturellen und religiösen Traditionen ab.
Christliche Traditionen: Begräbnisfeiern, Messen und Gedenkgottesdienste schaffen Raum für Gemeinschaft und Hoffnung.
Jüdische Tradition: Mit der „Schiv’a“, einer siebentägigen Trauerzeit, rücken Gemeinschaft und Erinnerung in den Vordergrund.
Islamische Tradition: Rituale wie das rituelle Waschen, die Einhüllung in ein Leinentuch und das Totengebet geben Halt.
Buddhistische Traditionen: Meditation, Gebete und Rituale begleiten den Verstorbenen durch den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt.
Umgang: Es ist wichtig, kulturelle und religiöse Unterschiede zu respektieren und Angehörigen den Raum zu lassen, ihre Rituale zu leben. Auch persönliche, nicht-religiöse Formen des Erinnerns verdienen Anerkennung.
Vielfalt akzeptieren
Das Wissen um unterschiedliche Trauerwege hilft, Missverständnisse zu vermeiden. Manche Menschen weinen viel, andere ziehen sich zurück. Kinder wechseln zwischen Spiel und Traurigkeit. Männer drücken Trauer im Tun aus, Frauen im Reden. Keine dieser Formen ist mehr oder weniger wert.
Umgang damit: Offenheit, Respekt und die Bereitschaft zuzuhören sind die wichtigsten Begleiter. Es geht weniger darum, Lösungen zu finden, sondern darum, einfach da zu sein.
Wichtiger Hinweis
Ob still oder laut, gemeinschaftlich oder zurückgezogen – jede Form der Trauer ist ein Ausdruck von Liebe. Angehörige dürfen ihren eigenen Weg gehen und sollten auch anderen zugestehen, dass ihr Weg anders aussieht.
Quellen:
Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. L. (Hrsg.). (2014). Continuing bonds: New understandings of grief. Taylor & Francis.
Neimeyer, R. A. (2016). Techniques of grief therapy: Assessment and intervention. Routledge.
Worden, J. W. (2018). Grief counseling and grief therapy: A handbook for the mental health practitioner (5. Aufl.). Springer Publishing Company.
Hospiz Österreich. (o. J.). Trauerbegleitung. Abgerufen am 6. September 2025, von https://www.hospiz.at/trauerbegleitung