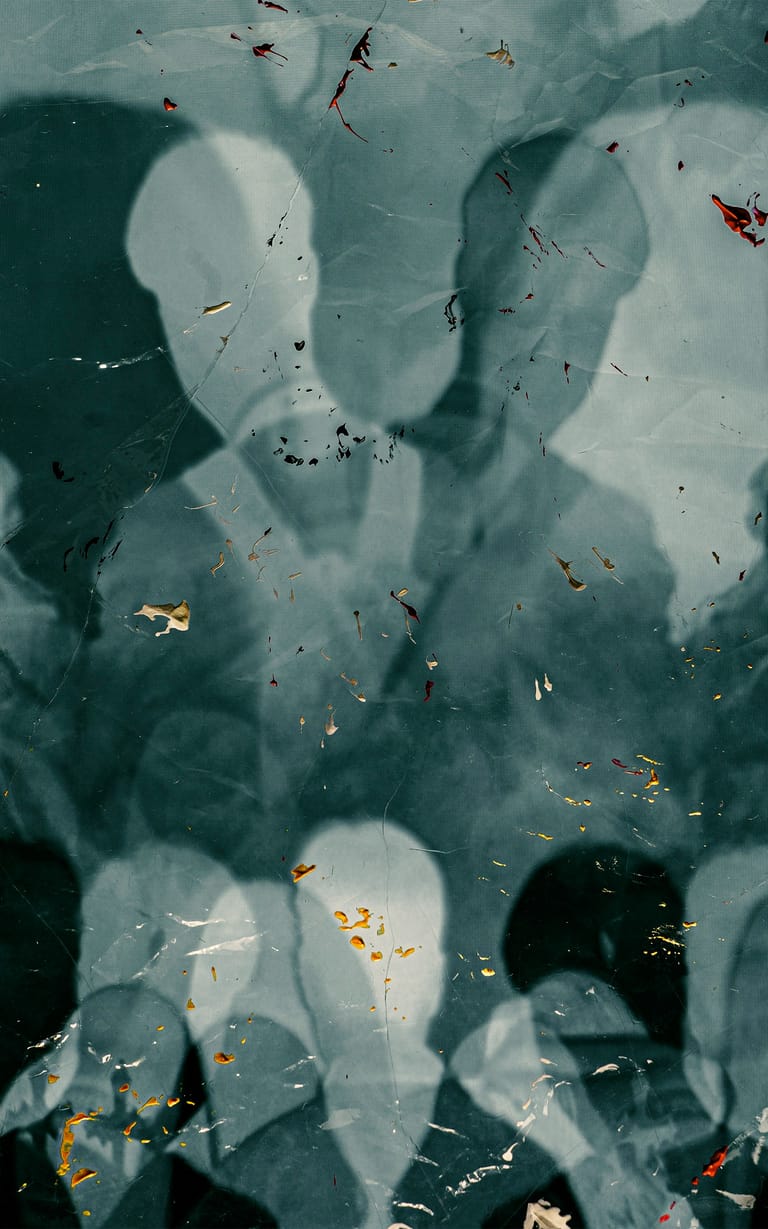Therapie bei Delir
Ein Delir ist ein akuter Verwirrtheitszustand, der plötzlich auftreten kann und für Betroffene wie auch Angehörige sehr belastend ist.
Allgemein
von Dr.in med. univ. Elisabeth Sciri
Bei schwer erkrankten Menschen kann besonders in der Sterbephase, aber auch davor ein sogenanntes Delir auftreten.
Es handelt sich um akut auftretende Veränderungen des Bewusstseinszustandes und stellt in der Palliativmedizin einen Notfall dar, der abseits der Sterbephase mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert ist.
Die Ursachen sind organische Beeinträchtigungen der Gehirnfunktion.
Das Screening erfolgt über die Confusion Assessment Method (CAM), die dem betreuenden Fachpersonal hilft, die Diagnose eines Delirs zu stellen.
Merkmale:
Diffuse Störungen des Denkens
Aufmerksamkeitsstörungen
Wahrnehmungsstörungen / Halluzinationen
Wahnvorstellungen
Gestörte Denkabläufe
Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus
Emotionale Schwankungen
Aggressionen
Veränderungen in der Psychomotorik (Hypo- oder Hyperaktivität)
Ursachen
Die Ursachen eines Delirs können vielfältig und auch multifaktoriell sein.
Risikofaktoren:
Krankenhausaufenthalte
Demenz
Alter
Stress
Einnahme vieler Medikamente
Weitere Ursachen:
Medikamente (Schmerzmittel, Medikamente gegen Krampfanfälle, Parkinson-Medikamente, Chemotherapeutika etc.)
Schmerzen
Infektionen
Veränderungen im Elektrolythaushalt oder Blutzuckerentgleisungen
Veränderungen im zentralen Nervensystem (erhöhter Hirndruck, Gehirntumoren, Gehirnmetastasen, Krampfanfälle etc.)
Entzugssyndrome (Alkohol, Nikotin, Steroide etc.)
Mangelerscheinungen (Dehydratation, Sauerstoffmangel, Vitaminmängel)
Andere Erkrankungen (Harnverhalt, Verstopfung, vorbestehende psychiatrische Erkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen)
Behandelbare Auslöser eines Delirs sollten immer evaluiert und behandelt werden.
Nicht-medikamentöse und prophylaktische Basismaßnahmen
Ruhige und sichere Umgebung schaffen (kein Lärm, Lichtanpassung)
Soziale Anbindung: Angehörige / vertraute Personen einbeziehen und professionell begleiten
Berührungen durch vertraute Personen, Kontinuität in der Pflege
Ruhige Kommunikation ohne Zurechtweisen
Einfache und kurze Sätze, keine komplexen Fragen
Mobilität zulassen und ggf. unterstützen
Entspannende Musik und Gerüche
Psychologische Mitbetreuung (auch der Angehörigen)
Sturzprophylaxe
Basale Stimulation (Aromaöle, Massage, Berührungen)
Ziel: Verbesserung der Orientierung, Förderung der Körperwahrnehmung, Reduktion von Angst und Unruhe, Verständnis für die veränderte Situation.
Diese Basismaßnahmen haben Vorrang vor medikamentösen Therapien.
Medikamentöse Therapie
Die Therapie richtet sich nach den Leitsymptomen.
Agitation / Angst / Wahn
Neuroleptika:
Haloperidol (bei Entzugsdelir)
Melperon, Pipamperon
Quetiapin (bei Patient:innen mit Morbus Parkinson)
Risperidon (bei lebhaften Halluzinationen, bei Demenz zugelassen; nicht sedierend, kombinierbar mit anderen Neuroleptika)
Clozapin (bei Patient:innen mit Morbus Parkinson und Halluzinationen)
Angst / Sedierung gewünscht
Benzodiazepine:
Lorazepam
Diazepam
Midazolam
⚠️ Bei älteren und geriatrischen Patient:innen vorsichtiger Einsatz wegen Sturzgefahr und paradoxer Wirkungen.
Verlangsamung / hypoaktives Delir
Neuroleptika
Delir in der Sterbephase
In den letzten Lebenstagen bis -stunden kommt es mit knapp 90 % sehr häufig zu Verwirrtheitszuständen.
Die Unterscheidung zu terminaler Unruhe oder Angst ist oft schwierig.
Wichtig:
prophylaktische Basismaßnahmen
gute Symptomkontrolle (v. a. Schmerzmedikation, Behandlung von Atemnot und Übelkeit)
Medikamente:
Haloperidol = Neuroleptikum der Wahl
bei starker Unruhe Kombination mit niedrigpotentem Antipsychotikum (z. B. Levomepromazin) oder Benzodiazepin (z. B. Lorazepam, Midazolam)
Bei therapierefraktärem Delir in der Sterbephase kann eine kontinuierliche Sedierung zur Symptomlinderung notwendig werden (siehe Palliative Sedierung).
Hinweis
Die hier bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung. Sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung, Diagnose oder Therapie. Medikamente dürfen nur nach ärztlicher Verordnung und niemals in Eigenregie eingenommen oder angepasst werden. Bitte besprechen Sie individuelle Beschwerden und Therapieentscheidungen immer mit den behandelnden Ärzt:innen.
Quellen:
CCC-Netzwerk Palliativmedizin. (2022, Dezember). SOP Akuter Verwirrtheitszustand. Abgerufen am 25. September 2025, von
Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe & AWMF). (2015, Mai). Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung (Kurzversion 1.1) (AWMF-Registernummer 128/001OL). https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/LL_Palliativmedizin_Kurzversion_1.1.pdf (abgerufen am 01.10.2025)