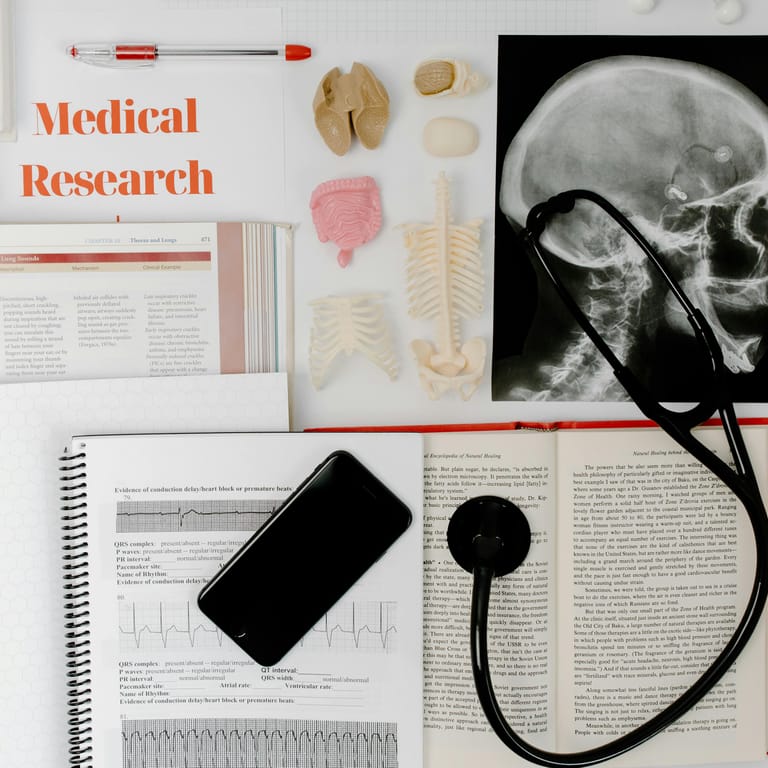Palliative Strahlentherapie
Die Strahlentherapie ist neben Operation und Chemotherapie eine der drei Hauptsäulen der Krebsbehandlung. In palliativen Situationen dient sie vor allem dazu, Symptome zu lindern und Lebensqualität zu erhalten.
Allgemeines
von Dr.in med. univ. Elena Salamun, BSc
Eine Strahlentherapie wird auch als Radiotherapie (RT oder RTX) bezeichnet. Sie bedeutet den Einsatz von energiereicher elektromagnetischer Strahlung, meist zur Behandlung von bösartigen Krebserkrankungen.
Neben der Operation und der Chemotherapie ist sie der dritte große Therapieansatz bei Krebserkrankungen. Oft wird sie nicht allein, sondern als Ergänzung eingesetzt.
In palliativen Situationen – bei weit fortgeschrittenen, nicht mehr heilbaren Erkrankungen – dient die Strahlentherapie zur Symptomlinderung.
Das Ziel ist die Verbesserung und Erhaltung der Lebensqualität. Dabei wird ein kurzes Therapieintervall mit möglichst wenigen Nebenwirkungen angestrebt.
Begrifflichkeiten
neoadjuvant – Bestrahlung vor der Operation zur Tumorverkleinerung
adjuvant – postoperativ zur Abtötung verbliebener Tumorzellen und Senkung des Rezidivrisikos
alleinige Strahlentherapie – selten möglich, z. B. bei Prostatakarzinom
Radiochemotherapie – Kombination mit Chemotherapie; die Chemotherapie erhöht die Strahlenempfindlichkeit des Tumors
Symptomlindernde Einsatzmöglichkeiten in der Palliativmedizin
Knochenmetastasen
lokale Bestrahlung bei Knochenabbau → Remineralisierung, Stabilisierung, Bruchprophylaxe
Linderung schmerzhafter Knochenmetastasen
Kompression durch Tumoren oder Metastasen
z. B. Weichteilmetastasen oder Hirnmetastasen → Schmerzen, Atemnot, neurologische Defizite
Bestrahlung im Brustbereich, wenn Tumoren Gefäße komprimieren
Hirnmetastasen: Verzögerung von Funktionseinschränkungen
Weichteilmetastasen: Schmerzlinderung
Blutungen
z. B. bei Hautmetastasen oder gynäkologischen Tumoren
Prinzip der Strahlentherapie
Hemmung der Zellteilung und Zerstörung von Tumorzellen
Verkleinerung der Tumormasse
Wirkung kann auch außerhalb des Bestrahlungsfokus auftreten → Risiko für Schädigung gesunden Gewebes
Bestrahlungsarten
Perkutane Bestrahlung (Teletherapie)
durch die Haut, mit optimaler Eindringtiefe und Bestrahlungswinkel
meist mit Gamma- oder Elektronenstrahlung
häufigste Form
Brachytherapie
Kontaktbestrahlung in Körperhöhlen oder -öffnungen durch radioaktive Quellen
z. B. bei Prostatakrebs
Weitere:
intraoperative Strahlentherapie (IORT)
metabolische Strahlentherapie (z. B. Strontium-89 i. v., das sich in Tumormassen anreichert)
Ablauf
Aufklärungsgespräch: Ziel, Dauer, mögliche Akut- und Spätnebenwirkungen
Planungs-CT und Terminvereinbarung für die erste Bestrahlung
Erstellung eines individuellen Bestrahlungsplans
Zusammenhang von Bestrahlungsdauer und Dosis
Fraktionierung: Aufteilung der Gesamtdosis in tägliche kleine Einzeldosen
Abhängig von Tumorart und Therapieziel:
höhere Dosen bei kürzerer Dauer oder
geringere Dosen über längere Zeit
Erreichte Maximaldosis → weitere Bestrahlung manchmal nicht möglich
In der Palliativmedizin meist Hypofraktionierung: höhere Einzeldosen bei kürzerer Dauer, um Liegezeit im Krankenhaus oder Anzahl der Besuche zu reduzieren
Mögliche Nebenwirkungen und Komplikationen
Allgemeine Begleiterscheinungen
Hautreaktionen (Rötungen, Schuppungen)
Müdigkeit, Abgeschlagenheit
Akute Nebenwirkungen (bis 90 Tage nach Ende)
Schleimhautentzündungen im Mund oder in der Speiseröhre (Kopf-Hals-Region)
Schluckstörungen
Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle (Bauchbereich)
Hautrötungen, Juckreiz
Blutarmut, Infektanfälligkeit (Knochenmark)
Spätnebenwirkungen (Monate bis Jahre später)
Hautverfärbungen, Verhärtungen des Unterhautfettgewebes
Mundtrockenheit bei Bestrahlung der Speicheldrüsen, Strahlenkaries
Funktionsstörungen von Lunge oder Darm
Schilddrüsenfunktionsstörungen
Fertilitätsstörungen
Zweitmalignome
Hinweis Zahnsanierung
Bei Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich sollten notwendige Zahneingriffe (z. B. Extraktionen, Rekonstruktionen) vor Beginn abgeschlossen sein, da die Heilung danach deutlich erschwert ist.
Ziel einer Bestrahlung
Das Ziel ist die optimale Dosis-Wirkungsbeziehung bei größtmöglicher Schonung gesunden Gewebes.
Durch moderne digitale, computergestützte Verfahren (z. B. 3D-Planung) ist heute eine präzisere Bestrahlung mit geringeren Nebenwirkungen möglich.
Hinweis
Die hier bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung. Sie ersetzen keine ärztliche Untersuchung, Diagnose oder Therapie. Medikamente dürfen nur nach ärztlicher Verordnung und niemals in Eigenregie eingenommen oder angepasst werden. Bitte besprechen Sie individuelle Beschwerden und Therapieentscheidungen immer mit den behandelnden Ärzt:innen.
Quellen:
Fehm, T., et al. (Hrsg.). (2021). Referenz Gynäkologie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. https://doi.org/10.1055/b-006-149614
Kreuzer, K.-A. (Hrsg.). (2019). Referenz Hämatologie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. https://doi.org/10.1055/b-004-140282